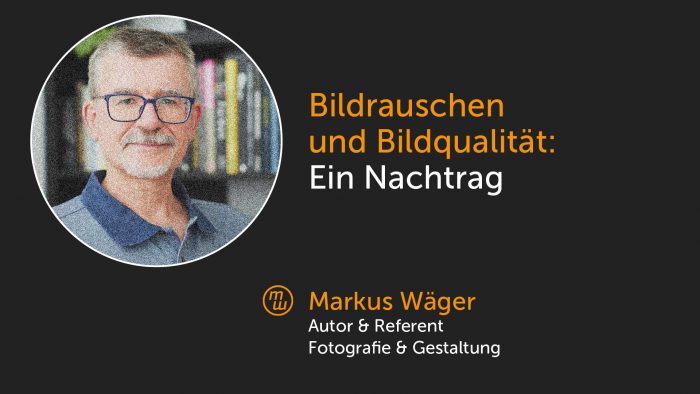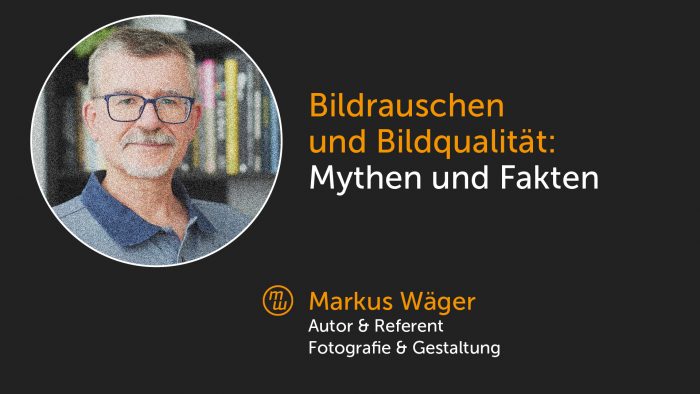Kreativ fotografieren 12: Belichtung und Belichtungsmodi
Dies ist ein Grundlagenvideo, mit dem ich mich vor allem an die Einsteiger in die Fotografie wende. Ich erkläre hier wie Belichtung zustande kommt, Verschluss- bzw. Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit und was die verschiedenen Belichtungsmodi an der Kamera mache. Wie alle bisherigen Videos geht es hier um die Grundlagen – die Details und die kreative Anwendung beschreibe
Kreativ fotografieren 12: Belichtung und Belichtungsmodi Beitrag anzeigen