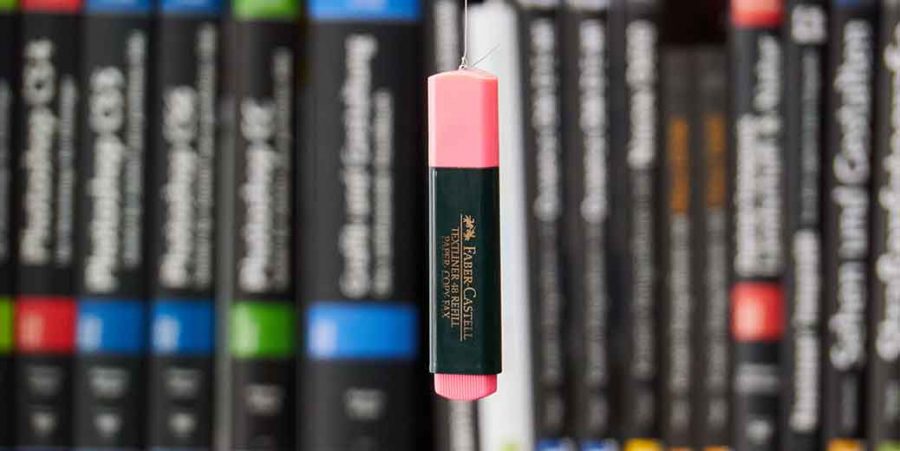APS-C oder MFT?
Als ich dieser Tage den Gedanken von Tony Northrop und anderen Bloggern und Vloggern folgte, die über eine Ende von MFT schwadronieren, stand ich plötzlich vor der Frage nach der Zukunft von APS-C. Sofern die einseitige Betrachtung einiger Vollformat-Fans nicht soweit zu einem Mainstream anschwillt, dass Einsteiger das Format meiden und ihm dadurch eine wichtige
APS-C oder MFT? Beitrag anzeigen